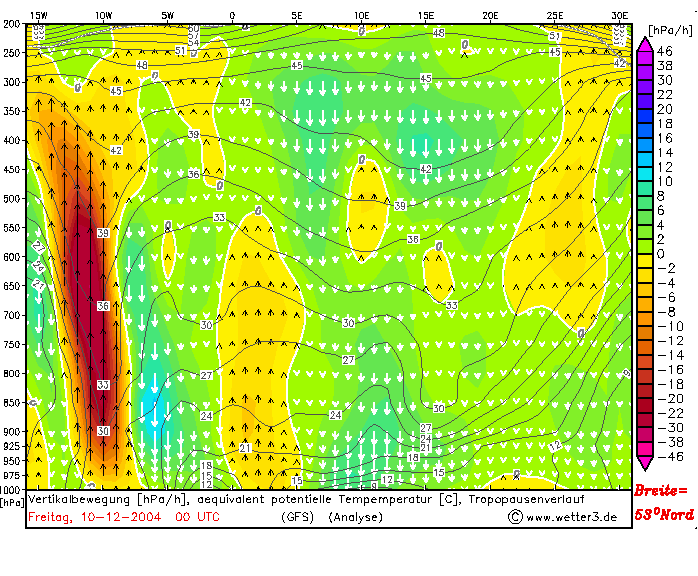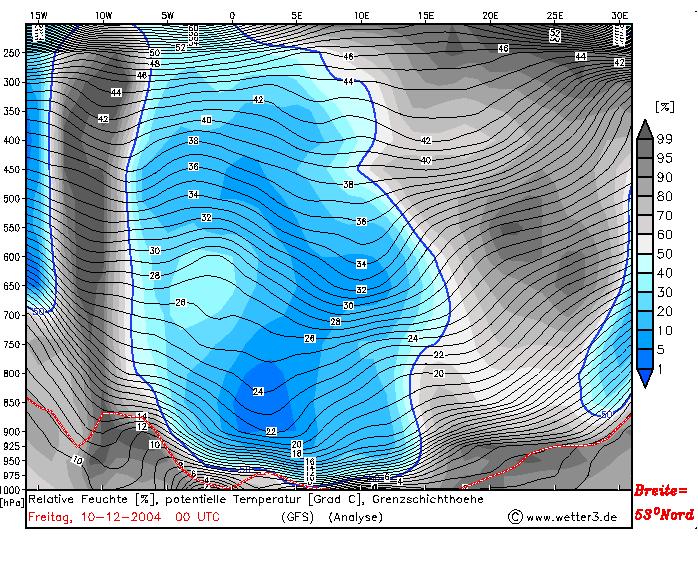Synoptische
Kurzanalyse für Deutschland
ausgegeben
am Freitag, den 10.12.2004 um 13:00 Uhr MEZ
Benutzte
Modelle: GME (R192F) Fr 00 UTC, ECMF Fr 00 UTC, GFS Fr 00 UTC
Synoptischskalige
Wellensituation:
Langwellenkeil Mitteleuropa
aktuelle
Situation:
Die
insgesamt nahezu quasizonale nordhemisphärische Zirkulation
erfährt aktuell ihre größte Störung im Bereich
Mitteleuropa durch einen massiven Langwellenhochkeil, welcher infolge
einer diffluenten Höhenströmung im Nordatlantik generiert
wird.

Mit dem resultierenden polwärtigen Ast des Jetstreams
werden warme Luftmassen subtropischen Ursprungs in hohe Breiten
gebracht. Nach dem Erhaltungssatz der isentropen
potentiellen Vorticity bekommen Luftmassen auf ihrem polwärtigen
Weg zunehmend antizyklonale relative Vorticity aufgeprägt.
Dieser als Beta-Effekt bezeichneter rücktreibender Prozess
beschreibt dann auch anschaulich, warum sich über Mitteleuropa
ein Langwellenkeil und eine entsprechende Bodenantizyklone ausbilden
kann. Warmluftmassen, die ohnehin eine antizyklonale Bahn beschreiben,
können zudem ihre vertikale Mächtigkeit nahezu aufrechterhalten.
Vor allem im Zentrum des antizyklonalen Höhenwirbels über
Deutschland (7°E-15°E) ist diese Warmluft (cSp) im unten
abgebildeten Vertikalschnitt in 53°N sehr schön zu sehen.
Ebenso ist in ca. 10°E anhand der umlaufenden und schwachen
Horizontalwinde sehr gut die nahezu senkrechte Achse der Antizyklone
zu erkennen. Bedingt durch nächtliche Ausstrahlung und fehlende
vertikale Durchmischung erreicht die Warmluft allerdings nicht den
Boden. Demzufolge ist überall in Deutschland inversionstypisches
Wetter zu beobachten.

Auf den weiteren Schnitten (Vertikalbewegung und relative Feuchte)
sind sehr anschaulich die weiteren direkten Folgen dieser Wetterlage
zu erkennen.
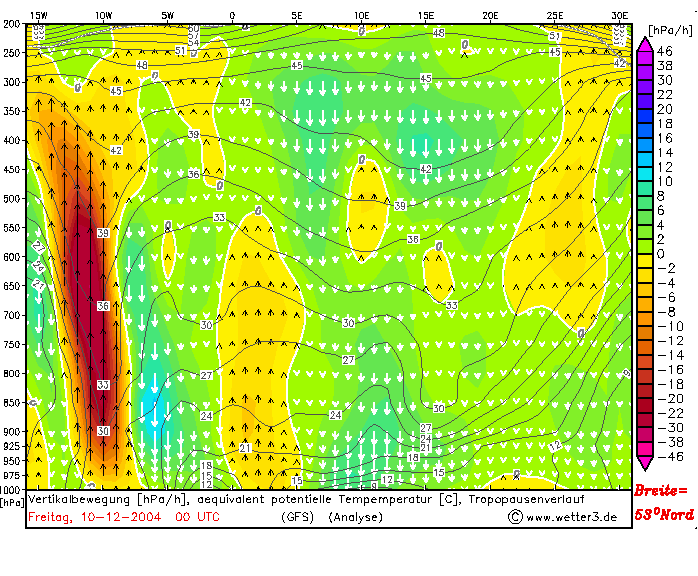
So führt das großskalige Absinken zu einer Austrocknung
nahezu der gesamten vertikalen Schicht. Dieses Absinken war nun
sogar so massiv, dass selbst die bis dato sehr feuchte Grundschicht
in diesen Austrocknungsprozess mit einbezogen wurde. Begünstigend
für den damit verbundenen Auflösungsprozess des Hochnebels
waren ferner die überwiegend südöstlichen Bodenwinde,
die trockene kontinentale Eigenschaften advehieren.
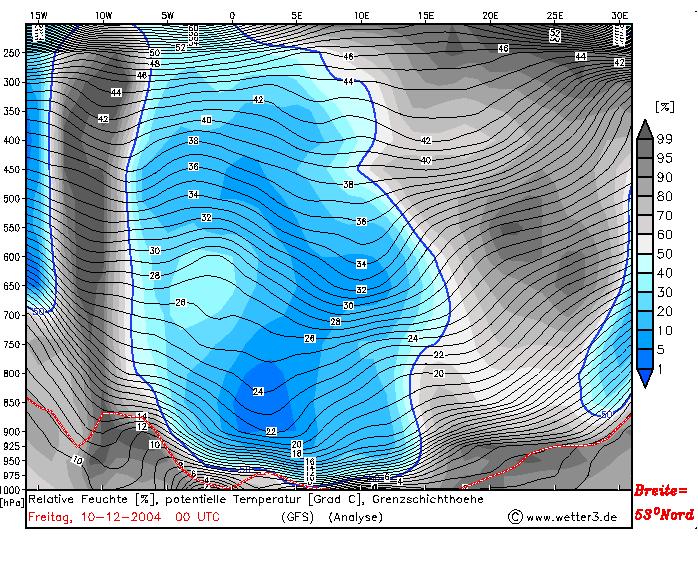
Alle Kurzwellentröge mit ihren wetteraktiven Frontensystemen
werden durch diese blockierende Situation praktisch dazu gezwungen
einen großen Bogen um Mitteleuropa zu machen.
Mit dem etwas schwächeren Südast des Jetstreams
konnten im Gegenzug polare Lufmassen bis weit nach Süden vorankommen.
Infolgedessen hat sich ein Höhenwirbel angefüllt mit Höhenkaltluft
über Südeuropa gebildet. In diesem Zusammenhang herrscht
vor allem über dem Mittelmeer durch den zusätzlich forcierenden
diabatischen Wärmefluss rege konvektive
Aktivität.
Beschreibung
des Kurzfristzeitraums (Tage 1 bis 3)
Auch
im Kurzfristzeitraum bleibt die Strömungssituation quasistationär.
Ein Kurzwellentrog verlagert sich mit dem Polafront-Jetstream
an Tag 1 (Freitag) von Schottland bis nach Westskandinavien. Die
zugehörige Kaltfront erreicht am Samstag (Tag 2) dann von Nordwesten
her Deutschland. Allerdings verliert sie durch den zunehmend antizyklonalen
Einfluss ihre baroklinen Eigenschaften und sie bleibt nur noch als
Inversion sichtbar. Dennoch besteht dann in Norddeutschland allgemein
wieder eine größere Neigung zu Hochnebel und Sprühregen.
Der an Tag 1 über dem Nordatlantik bereits angedeutete Austrogungsprozess
wird nun auch am Folgetag fortgesetzt. Für Mitteleuropa ändert
sich diebezüglich allerdings relativ wenig, so dass auch am
Sonntag (Tag 3) ein ausgeprägter Langwellenhochkeil mit einer
zugehörigen Bodenantizyklone nach allen Modellen wetterbestimmend
bleibt.
Beschreibung
des Mittelfristzeitraums (Tage 4 bis 7)
Relativ einstimmig beurteilen die verwendeten Modelle auch die weitere
Entwicklung im Mittelfristzeitraum. Ein sich nähernder Jetstreak
sorgt für eine zunehmende Zonalisierung ab Montag (Tag 4),
wobei jedoch die Frontalzone weiterhin allgemein winteruntypisch
sehr weit nördlich verläuft. Somit wird auch weiterhin
maximal der Norden Deutschlands von schwachen Frontensystemen
getroffen. Ab Tag 5 (Dienstag) zeigen alle Modelle in Zusammenhang
mit dieser Zonalisierung ein erhöhtes Potential zur Bildung
einer Steuerungszyklone, wobei Deutschland vor allem nach GFS ab
Tag 6 (Mittwoch) auch von einem zugehörigen Sturmfeld erfasst
werden soll. GME und ECMWF belassen Deutschland dagegen nur im südlichen
Randbereich dieser zyklonalen Entwicklung.
©
Marcus Boljahn
back
to top
copyright
by www.diplomet.de
protu@met.fu-berlin.de
|